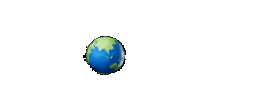Der dreieinige Gott – heute eine Selbstverständlichkeit für Christen. Doch das war mal umstritten. Für Klarheit gesorgt hat das Konzil von Nizäa – vor 1700 Jahren: der Auftakt der Artikelserie zum runden Geburtstag.
Die christlichen Gemeinden waren von den römischen Behörden über fast drei Jahrhunderte mehr oder weniger intensiv verfolgt worden. Christen wurden um ihres Glaubens willen getötet, wurden denunziert und innerhalb der Gesellschaft benachteiligt.
Das änderte sich durch Kaiser Konstantin, der von 306 bis 337 n. Chr. herrschte und im Jahr 313 Religionsfreiheit verkündigte. In den Jahren danach wurde das Christentum nicht nur geduldet, sondern anderen Religionen gegenüber sogar bevorzugt und massiv gefördert. Konstantin sah in der christlichen Kirche einen unübersehbaren Machtfaktor.
Insofern hatte der Kaiser, der kein Christ war und sich erst kurz vor seinem Tod taufen ließ, ein Interesse daran, dass die christliche Kirche als verlässliche Größe innerhalb des Reiches erhalten blieb. Also beobachtete er mit Interesse die Entwicklung der christlichen Gemeinde, deren Anziehungskraft durch die Duldung und schließlich Privilegierung zunahm. Und da tat sich Entscheidendes.
Dem Geheimnis auf der Spur
Am Beginn des dritten Jahrhunderts n. Chr. hatte sich der theologische Streit über die Frage, ob Vater und Sohn gleichermaßen wahrer Gott sind, verschärft. Die Auseinandersetzung, ob der Sohn Geschöpf oder gleich ewig mit dem Vater ist, drohte die Einheit der christlichen Kirche innerhalb des römischen Reiches zu gefährden.
Im Neuen Testament gibt es viele Aussagen zu Wesen und Werk Jesu, die seine Göttlichkeit betonen und auf die göttlichen Aspekte seines Wirkens und Wesens hinweisen. Allerdings finden sich dazu keine weitergehen Erklärungen. Und so sah man sich in den nachfolgenden Jahrhunderten genötigt, dieses Problem theologisch zu durchdenken und lehrmäßig zu erfassen.
Die beiden vielleicht wichtigsten Entwürfe, in denen versucht wurde, das Geheimnis Gottes – also von Vater, Sohn und Heiligem Geist – zu verdeutlichen, stellen der Subordinatianismus und der Modalismus dar.
Schöpfer und Geschöpfe
Der Subordinatianismus(von Subordination = Unterordnung)vertritt die Position, dass der Logos oder Sohn ein Geschöpf Gottes ist, dass dem Vater nur wesensähnlich ist, doch keinesfalls gleich ist. Man war der Ansicht, dass Sohn und auch der Heilige Geist von Gott vor aller Zeit geschaffen wurden. Von daher sind Sohn und Geist dem wahren Gott nachgeordnet beziehungsweise untergeordnet.
Diese Position hatten im zweiten und beginnenden dritten Jahrhundert die meisten Anhänger. Allerdings: Der Subordinatianismus steht in der Gefahr, den Monotheismus zu relativieren und Gott Neben- oder Untergottheiten an die Seite zu stellen.
Facetten einer Einheit
Der Modalismus (von Modalität = Art und Weise, Möglichkeit) vertritt die Ansicht, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist bloße Erscheinungsweisen oder Offenbarungen des einen Gottes sind, während Gott in sich einer ist. Demnach ist Gott in der Heilsgeschichte als Vater, dann als Sohn und als Heiliger Geist erfahrbar, während er in seinem Innern immer nur einer ist.
Der Modalismus ist darum bemüht, die innere Einheit Gottes herauszustellen, um zu verhindern, dass der Glaube an den einen Gott relativiert wird. Allerdings besteht die Gefahr, dass die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus nur zum Anschein geschieht und an sich keinen Realitätscharakter besitzt.
Welche theologische Sichtweise sich durchsetzte, das sollte erst das Konzil von Nizäa zeigen. Darum geht es im nächsten Teil dieser Serie.
Hintergrund: Was die Bibel zur Dreieinigkeit sagt
Im Neuen Testament wird die Göttlichkeit des Sohnes bezeugt. So wird im Johannesevangelium vom Logos, dem göttlichen Wort, dass in Jesus Gott Mensch wurde, gesagt: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort“ (Joh 1,1). Die Bezeichnung Gott für den menschgewordenen Logos findet sich einige Male im Johannesevangelium (Joh 1,17; 20,28). Im Neuen Testament wird auch deutlich gemacht, dass der Gottessohn vor seiner Menschwerdung bei Gott – also präexistent – war. In Phil 2,6 wird von Jesus Christus als „göttliche Gestalt“ im Himmel (Phil 2,6.7) gesprochen, die Mensch wurde und sich so erniedrigte.
Der häufigste und nachdrücklichste Hinweis darauf, dass in Jesus Gott gegenwärtig ist, stellt die Bezeichnung „Kyrios“ (Herr) da. In der Septuaginta, der vorchristlichen Übersetzung der heiligen Schriften des Alten Bundes ins Griechische, dient „Kyrios“ zur Bezeichnung für Gott. In den neutestamentlichen Schriften wird diese Bezeichnung auch auf Jesus übertragen (z.B. Mt 9,28; Lk 5,8). In Apg 10,36b wird Jesus „Herr über alles“ genannt; und Paulus betont – und dies lässt sich schon als Hinweis auf die Einheit der göttlichen Personen lesen: „Und niemand kann sagen: Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist“ (Röm 12,3b).
Während der Geist Gottes im Alten Testament nicht als Person, sondern als göttliche Lebenskraft verstanden wird, spricht das Neue Testament vom Heiligen Geist als Person. Im Johannes-Evangelium ist der Heilige Geist derjenige, der die Jünger und die Gemeinde an Wort und Tat Jesu erinnert (Joh 14,26). Der Heilige Geist ist der „andere Tröster“, der Jesus in der Zeit der Kirche vertritt und Erkenntnis schenkt, wie Jesus es tat (Joh 16,8–11). Es wird auch davon gesprochen, dass der Heilige Geist „lehrt“ (Lk 12,12), spricht und befiehlt (Apg 13,2), Bischöfe einzusetzen (Apg 20,28) oder missionarische Aufträge erteilt (Apg 8,29). Außerdem lehrt der Heilige Geist das rechte Beten (Röm 8,26). Von der unbedingten Zusammengehörigkeit von Gott und Geist wird in 1Kor 2,11 gesprochen und in 2Kor 3,17 wird der Heilige Geist – ganz so wie Jesus Christus und der Vater – „Herr“ genannt. Damit wird seine Göttlichkeit und Personhaftigkeit unterstrichen.
Bei der Taufe Jesu offenbaren sich der Vater und der Heilige Geist. Der Vater bekennt sich zum Sohn und der Heilige Geist ist stetiger Begleiter des Menschen Jesu. Auch die enge Verbindung zwischen Jesus Christus und dem Parakleten – also dem Helfer und Tröster – der den erhöhten und in den Himmel gefahrenen Herrn in der Kirche vergegenwärtigt, kann als Hinweis auf das Geheimnis der Dreieinigkeit verstanden werden: Sohn und Geist stehen in Einheit mit dem Vater, so dass Wort und Wille des Vaters zugleich Wort und Wille des Sohnes und des Geistes ist (Joh 16,13–15).
Zudem lassen sich die dreigliedrigen Aussagen in 1Kor 12,4–6 oder die Segensformel in 2Kor 13,13 als wichtige Hinweise auf die Dreieinigkeit Gottes verstehen.
Foto: Hyejin Kang – stock.adobe.com