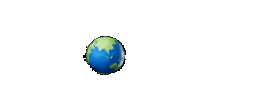Brot und Wein: „Das ist mein“ Leib und Blut. Über die Worte Jesu beim letzten Abendmahl zerbrechen sich die Christen seit 2000 Jahren die Köpfe. „Ist“ – was heißt das? Die Antworten sind geprägt von der Denkweise der jeweiligen Zeit.
Warum ist das überhaupt wichtig? Es geht um die Gegenwart Jesu Christi beim Heiligen Abendmahl. Aber hat er nicht gesagt, dass er da ist, wo sich zwei oder drei in seinem Namen versammeln? Klar, allerdings hat er auch gesagt, was man essen und trinken muss, um ewiges Leben zu erhalten: Es geht um die Gegenwart von Leib und Blut Christi beim Abendmahl – die sogenannte Realpräsenz.
Eine Frage, mehrere Antworten
Um solche Fragen haben sich die Christen der ersten Jahrhunderte wenig Gedanken gemacht: Sie feierten das Herrenmahl einfach. Wendepunkt war mal wieder die konstantinische Wende im vierten Jahrhundert. Da entwickelte sich das Christentum zur Staatsreligion und bekam massenhaft Zulauf. Die vielen Taufkandidaten erhielten Unterricht (Katechese), und der brauchte Lehrstoff.
Die griechischen Kirchenväter fanden ihre Erklärung bei den griechischen Philosophen im Urbild-Abbild-Schema. Demnach waren die Dinge der sichtbaren, materiellen Welt wesensgleiche Abbilder von Urbildern aus der unsichtbaren, wahren Welt des Schönen und des Guten. Und so konnten in den Abbildern Brot und Wein ganz einfach die Urbilder Leib und Blut Christi gegenwärtig sein.
Die lateinischen Kirchenväter hatten ihre eigenen Ideen. Der einflussreichste sah Brot und Wein als Zeichen (signum) von Leib und Blut, der eigentlichen Sache (res). Das meinte jedoch mehr als einen bloßen Symbolcharakter: Denn wo kein Rauch, da auch kein Feuer. Das Zeichen hängt wesentlich mit der Sache zusammen.
Streit ums Entweder-oder
Rund 400 Jahre lange blieb die Frage grundsätzlich ungeklärt. Und die Kirche hielt unterschiedliche Antworten aus. Das änderte sich im achten Jahrhundert, je weiter sich das Christentum unter den Germanen und den Franken ausbreitete. Sie konnten mit dem vielschichtigen Wirklichkeitsverständnis der alten Griechen nichts anfangen.
In der neuen Denkweise gab es nur ein Entweder-oder – entweder Bild oder Sache, entweder Symbol oder Wirklichkeit. Und diese Polarisierung führte zu Auseinandersetzungen. Ab da pendelten die Interpretationen zwischen massiv-materiell und symbolisch-spirituell.
Höhepunkt waren die beiden Abendmahlstreite: Im neunten Jahrhundert gerieten der Abt eines fränkischen Klosters und einer seiner Mönche öffentlich aneinander. Und im elften Jahrhundert legte sich der Domschulleiter von Tours mit diversen Synoden an. Am Ende sollte er beschwören, dass die Zähne der Gläubigen den Leib Christi zerkauen – was er absurd fand.
Zurück zu den Griechen
Das Ende des Gezänks kam, als die Scholastiker am Vorabend der Renaissance die alten griechischen Philosophen wiederentdeckten. Hier fand sich das Erklärmuster von Substanz und Akzidenz, von Gehalt und Gestalt. Substanz meinte damals nicht die chemische Materie, wie das Wort heute meistens verstanden wird, sondern das innerste Wesen einer Sache. Und Akzidenz bedeutet dementsprechend die materiellen Eigenschaften.
Angewendet auf die Realpräsenz ergibt sich der Gedankengang: Brot und Wein behalten ihre Akzidenz, ihre äußere Gestalt, ihre materiellen Eigenschaften. Doch es wandelt sich ihre Substanz, ihr innerer Gehalt, ihr wahres Wesen. So sind Leib und Blut Christi nicht in der Materie, aber ihrem Wesen nach wahrhaftig gegenwärtig. „Transsubstantiation“ nennen Theologen dieses Konzept.
Rund 200 Jahre sorgt dieses Konzept für Ruhe. Doch dann kamen mit den Reformatoren neue Auseinandersetzungen. Davon berichtet die nächste Folge dieser Serie.
Foto: Igor Mojzes
Schlagworte