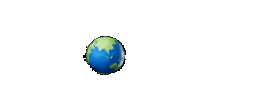„Ohne Haus und Herd kein Heim“, sagt Abu. Er ist als Flüchtling in ein fremdes Land gekommen, fernab seiner Heimat, seiner Kultur, seiner Familie. Ähnliches passiert heute weltweit jeden Tag. Was erwartet ihn, wie wird sein Leben sein?
Der 20. Juni erinnert an die vielen Flüchtlinge in dieser Welt. Heute nennt man sie Migranten. Auf der Flucht sind sie trotzdem. Seit 1914 steht dieser Tag im Erinnerungskalender der Menschheit. Damals waren Hunderttausende Menschen im Ersten Weltkrieg unterwegs. Viele davon sahen ihre Heimat nie wieder. Seit 2001 nennt sich der Gedenktag offiziell Weltflüchtlingstag.
Der Jahrestrend 2015 der UNO-Flüchtlingshilfe spricht Bände: 65 Millionen Menschen sind auf der Flucht, mehr als je zuvor. Rund die Hälfte davon sind Kinder. Kriege in Syrien, Südsudan, Irak, Hungerskatastrophen in Nigeria, Jemen – das setzt die Menschen in Gang. Die meisten flüchten übrigens in arme Länder. Reiche Länder nehmen die wenigsten Flüchtlinge bei sich auf. Sie liegen außerhalb jeglicher Erreichbarkeit. Stattdessen werden die Flüchtlingscamps in Afrika immer größer. Städte aus Zelten und Wellblechhütten erstrecken sich teilweise auf 50 Quadratkilometer.
Heimatlos sein ist ein Albtraum
„Heimat zu verlieren ist wie ein böser Traum“, sagt Abu. Er musste das Bekannte, das Vertraute, das Geliebte und zum Teil selbst Geschaffene eintauschen gegen das Unbekannte, Ungeliebte. Zwischen beiden Polen liegt häufig ein langer, mühsamer, gefährlicher Weg. Dass Flüchtlinge durch solche Umstände traumatisiert werden, ist nicht verwunderlich. „Ich will doch nur leben“, sagt Abu. Die Bibel spricht vom Bild des Vogels, der aus dem Nest flüchtet: „Wie ein Vogel, der aus seinem Nest flüchtet, so ist ein Mann, der aus seiner Heimat flieht“ (Sprüche 27,8).
Flüchtlingshilfe gehört zur Nächstenliebe
Dass das christliche Gebot der Nächstenliebe auch die Flüchtlingshilfe einschließt, liegt auf der Hand. Jesus selbst war Flüchtling. Er war gerade erst geboren, da mussten seine Eltern nach Ägypten fliehen. Zeitlebens sollte sich das nicht ändern, immer waren die Häscher hinter ihm her. Er wurde verfolgt, gejagt und ausgestoßen. Ebenso seine Apostel und die ersten Christen. Christsein ist eben vielfach auch beides: Verfolgt werden um des Evangeliums willen und zugleich für die eintreten, die verfolgt werden. Die eingesetzten Mittel dazu sind Gewaltfreiheit und Nächstenliebe. So wird die Welt besser, nicht durch Gewalt oder Vertreibung.
Freunde, Fremde, Feinde – alle sind „der Nächste“. Das sagt Stammapostel Jean-Luc Schneider in seinen Gottesdiensten immer wieder. Er meint damit sowohl die emotionale Hilfeleistung durch Gebet und Zuhören, aber auch die praktische Einzelhilfe. Zeichen der Solidarität mit den Flüchtlingen setzen auch die Gebietskirchen.
Flüchtlinge gibt es viele, zu viele
Die Genfer Flüchtlingskonvention definiert einen Flüchtling als Person, die „… aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will“ (Art. 1). Solche Flüchtlinge gibt es viele, zu viele.
Foto: Franco Volpato