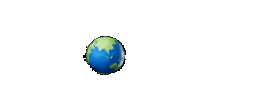Sie hießen Helene, Johanna, Simon und, und, und: Was Neuapostolische Christen jüdischer Herkunft aus Stuttgart erlebten und erlitten – ein Beitrag zum Welttag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am 27. Januar.
Der Advent 1941 beginnt frostig, Vorbote eines eiskalten Winters. Am nächsten Tag verlässt eine junge Frau den Killesberg in Stuttgart (Deutschland). Ihr Fußweg führt sie vorbei an einem Friedhof. Nach drei Kilometern trifft sie am Güterbahnhof ein. Sie ist unendlich einsam. Dabei begleiten sie mehr als tausend Menschen.
Die junge Frau heißt Helene Wöhr und ist Kindergärtnerin – mit wunderbaren Zeugnissen: „In ihrem Wesen liegt eine sehr liebe, fröhliche frische Art“, heißt es da. Sie sei „sehr kinderlieb“ und man lasse sie „nur ungern gehen“. Doch jetzt muss sie reisen.
Drei Tage zuvor hat sie sich von ihren Eltern verabschiedet – tränenreich. Da war ihr ganzes Vermögen bereits von der Gestapo beschlagnahmt worden. Bezirksapostel Georg Schall hatte Helene noch geraten, in die Schweiz zu gehen. Aber sie blieb – „aus Liebe und Sorge zu ihren Eltern“.
Eine Reise ohne Wiederkehr
Der „Adventszug“ ist ein Deportationszug. Ziel ist Riga in Lettland. Helene Wöhr hat lange nicht gewusst, dass sie jüdischer Herkunft ist. Ihre Eltern waren zunächst evangelisch. 1922 konvertierten ihre Mutter und ihr Stiefvater in die Neuapostolische Kirche. Ihre Mutter Anna Wöhr ist „Halbjüdin“. Helene selbst hat einen jüdischen Vater. Sie gilt – mit drei Großeltern jüdischer Religion –nach der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz 1935 als „Rassejüdin“.
Drei Tage und drei Nächte dauert die Reise. Im Ghetto von Riga ist „Platz geschaffen“ worden, tausende lettische Juden wurden erschossen. Helene und ihre Leidensgenossen vegetieren in teilweise offenen Ställen und Scheunen bei mitunter über minus 30 Grad Kälte. Sie müssen hart arbeiten. Es gibt kaum etwas zum Essen. Von der gut 1000-köpfigen „Reisegesellschaft“ überleben nur 43 Personen den Krieg.
Am 30. April 1942 schreibt Helene einen Brief an ihre Mutter Anna: Sie sei nun auch zum Tode verurteilt, „wenn es nur schon vorüber wäre“ – ihr letztes Lebenszeichen. Ihre beste Freundin, Margot Neumeier, berichtete viele Jahre später, dass sie oft von Helene geträumt hat. Dann sah sie Helene immer in einem mit Perlen besetzten Kleid.
Alles andere als eine Ausnahme
Das Schicksal von Helene Wöhr (1915-1942) war kein Einzelfall. Allein aus Stuttgart wurden mindestens sechs neuapostolische Christen jüdischer Herkunft in der NS-Zeit deportiert:
Fanny Perlen (1894–1941) war ebenfalls in dem Deportationszug nach Lettland und wurde ermordet. Josefine Glück (1872–1943) wurde 1942 nach Theresienstadt (tschech. Terezín) deportiert, wo sie aufgrund der Entbehrungen verstarb. Ihr Sohn Hermann Glück (1901–1969) war Beamter bei der Industrie- und Handelskammer. Trotz bester Zeugnisse wurde der „Halbjude“ entlassen. Seine Zeit als Zwangsarbeiter überlebte er gesundheitlich schwer angeschlagen.
Cecilie Sofie Barth (1873–1953), Johanna Dierheimer (1894–1971) und Simon Peritz (1884–1972) überlebten die Shoa, da sie in einer „privilegierten Mischehe“ gelebt hatten und mit „Ariern“ verheiratet waren. Aber auch sie wurden schließlich deportiert.
Liebevolle Herzen, hilfreiche Hände
Und was machte die Kirche? „Während der ganzen Jahre [der] nationalsozialistischen Herrschaft hat man mir und meiner Familie […] so viele Liebe, Hilfe, Unterstützung in Geld und Lebensmitteln, Rat und Trost seitens der Mitglieder und führenden Persönlichkeiten der Gemeinde […] zu teil werden lassen“, berichtete Hermann Glück am 2. Mai 1945.
„Treue Menschen, insbesondere der Vorsteher der neuapostolischen Kirche, reichten uns liebevoll und hilfreich die Hände“, erklärte Simon Peritz am 20. Juli 1945. Seiner Frau wurde „in dieser schweren Notzeit“ nach seiner Deportation „auch finanzielle Unterstützung zuteil“.
Die nach Theresienstadt schwer kranke Johanna Dierheimer bekundete am 24. Mai 1946: „Die Herren Geistlichen der Gemeinde […] haben mich […] reichlich mit Geldgeschenken bedacht, ohne welche ich mit meinen Kindern umgekommen wäre.“
Sowohl Johanna Dierheimer als auch Hermann Glück und Simon Peritz blieben der Kirche auch nach dem Krieg verbunden.
Helene Wöhr betreute die Kinder der Familie Heydt in einer ihrer letzten Stellen von Januar 1938 bis Dezember 1940. (Foto: Peter Heydt)
Über den Autor

Dr. Karl-Peter Krauss (geb. 1955) ist Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Geschichte der Neuapostolischen Kirchen“. Er studierte in Tübingen und promovierte zu einem historisch-geografischen Thema. Seine Bücher zur Kirchengeschichte finden viel Anerkennung auch unter Kritikern. Bis zu seiner Ruhesetzung im Jahr 2021 war er Gemeindevorsteher in der Gebietskirche Süddeutschland.