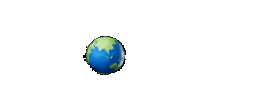Stern, Stall, Hirten, Engel – und ein weinendes Baby im Wohnzimmer. Weihnachten wird dieses Jahr nicht erklärt, sondern erlebt. Ein Weihnachtsartikel der anderen Art.
Ich hab’s wieder getan: ein To-do in die Schublade „später“ geschoben – und prompt vergessen. Ich sollte einen Artikel zu Weihnachten schreiben. Jetzt ist Wochenende, der Bildschirm offen, die Zeit knapp, und ich starre auf eine leere Seite.
Ich denke an meinen früheren Beruf in der Medien- und Werbewelt, verbunden mit dem Druck, noch schneller zu liefern. Advent war Hochsaison – nicht für Stille, sondern für Konsum. Und der musste angekurbelt werden: spontane Kampagnen aus dem Boden stampfen, panische Kunden beruhigen und Deals kurz vor Jahresende absichern – als hinge die Welt davon ab.
Heute schüttle ich über diesen Modus den Kopf. Wie kann man so getrieben durch die Zeit hetzen? Und doch bringt mich das Kopfschütteln kein bisschen weiter – der Cursor blinkt auf der leeren Seite, als würde er sagen: «Komm schon. Ein bisschen Bethlehem geht immer: Stern drüber, Stroh darunter und los geht’s…“
Leistung – überall, sogar im Glauben
Vielleicht ist das der Punkt: dieses Gefühl, liefern zu müssen – im Job, im Alltag, manchmal sogar im Glauben. Als Christ tappt man leicht in die Falle: Wenn ich genug tue, genug bete, genug richtig mache, dann … ja, dann was?
Wir machen aus Nächstenliebe ein Projekt: Aufgabenliste, Zeitfenster, am Ende ein innerer Haken. Und manchmal merke ich: Es geht nicht nur um den anderen, sondern auch um meinen Beleg, ein „guter Christ“ zu sein. Dabei ist genau das der Denkfehler: Gnade ist kein Lohn für fromme Leistung. Die Bibel sagt es unmissverständlich: „Aus Gnade seid ihr gerettet … nicht aus Werken“ (Epheser 2,8.9). Und noch klarer: „Nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit“ (Titus 3,5).
Und doch kennen wir das Muster: tun, liefern, abhaken. Es fühlt sich sicher an, aber es macht unruhig – weil es Gnade in eine Rechnung verwandelt, statt sie als Geschenk zu nehmen.
Mitten in meine Gedanken hinein höre ich ein Piepsen, wie eine Vorwarnung. Dann wird daraus ein Quäken, das ich inzwischen gut kenne: wach, ungeduldig, ziemlich bestimmt.
Effizienz scheitert an Babys
Das Quäken ist schnell identifiziert: Unser Baby meldet sich aus der Wiege zu Wort. Natürlich. Ich klappe das Notebook zu, gehe ins Wohnzimmer und beuge mich über ihn. Da ist dieses kleine, beleidigt dreinschauende Gesicht – Stirn gerunzelt, Blick streng. Die Botschaft ist klar: „Papa, so geht das nicht.“ Okay – was ist diesmal? Volle Windel? Hunger? Tut irgendwas weh?
Ich hebe ihn hoch in die Luft. Und die Stimmung kippt schlagartig. Erst dieses kurze Erstaunen – dann sein bestes Lachen. Pures Glück. Kein „weil du …“, kein „wenn du …“. Einfach Freude, weil Nähe da ist.
Ich trage ihn durch die Wohnung. Er strahlt mich an und ist völlig ruhig. Dann lege ich ihn zurück in die Wiege, damit ich „endlich“ wieder an den Artikel kann. Die Miene kippt sofort: dicke Tränen kullern über die Wangen, die Unterlippe bebt, die Mundwinkel ziehen nach unten – ein Drama in Zeitlupe.
Also wieder hoch. Ich setze mich aufs Sofa, er in meinen Armen. Nach ein paar Atemzügen wird es still und Zufriedenheit kehrt ein. Was er braucht, ist nicht die perfekte Lösung, keine Spieluhr, kein Lieblingskuscheltier. Er braucht Nähe.
„Jesus war als Baby bestimmt nicht so anstrengend“, sage ich. Unser Sohn gluckst, als wüsste er mehr. Und ich male mir aus, wie es Maria und Josef ging: mit einem Kind, das schreit, getragen werden will, Nähe braucht – mitten in einer engen, einfachen Wirklichkeit. Gott wird Mensch. Nicht groß. Nicht stark. Sondern klein. Als Baby.
Jesus beginnt nicht mit einer Tat, sondern wie jeder Mensch mit einem Atemzug. Es war zuerst einfach da. Ein leises Geräusch. Ein Körper, der Wärme braucht. Hirten kommen, später Weise – nicht, weil das Kind schon etwas „gebracht“ hätte, sondern weil Gott sich zeigt und Menschen sich auf den Weg machen.
Das Besondere ist nicht eine Leistung, sondern seine Gegenwart. Allein, dass er da ist, verändert alles: Der Stall wird zum Ort, an dem Gott wohnt – und Bethlehem zum Anfang einer neuen Geschichte.
Kleine grosse Liebe
Jesus beginnt als Baby. Dieses Bild ist mehr als berührend – es ist die erste Lektion: Beziehung nicht als Mittel zum Zweck. Nähe nicht als Belohnung. Nähe ist Leben. Und Gott kommt, um da zu sein.
Später wird Jesus vieles lernen – sprechen, gehen, arbeiten; vielleicht tatsächlich das Bauhandwerk wie Josef. Er wird Menschen begegnen, zuhören, trösten, Hoffnung geben. Seine „Leistung“? Im Kern: da sein – bis zum Äußersten.
Und plötzlich wirkt mein eigener Leistungsdruck klein. Weihnachten erinnert daran: Gottes Liebe kommt nicht erst, wenn wir liefern. Sie macht sich gerade dann erfahrbar, wenn wir nicht liefern können – wenn uns die Kraft fehlt, wenn wir unperfekt sind. Wir müssen nur Raum schaffen.
Ein Baby lehrt das Tempo der Geduld – oder anders gesagt: Es zwingt zur Entschleunigung. Es lässt sich nicht „effizient“ beruhigen. Das lernt man schnell. Liebe ist hier nicht produktiv, sondern präsent.
Am Ende habe ich fast das Gefühl, dass dieses kleine Bündel in meinem Arm mich umarmt und trägt. Da ist mehr Liebe, als ich mir selbst zutraue: Geduld, Zärtlichkeit, ein gutes Wort, tiefen Frieden. Nicht etwas, das man trainiert. Eher eine Quelle, die sprudelt, sobald Nähe entsteht. Und ich merke: Das Beste in mir lässt sich nicht an Leistung messen. Es entsteht aus Beziehung – aus dem einfachen, stillen „Ich bin da“.
Wer Christus nachfolgt, kann beim Baby in der Krippe anfangen: Dort, wo wir Menschen nicht optimieren, sondern ihr bloßes Dasein als Geschenk sehen. Wo wir einander annehmen, tragen und wertschätzen – ohne Zweck, einfach aus Liebe.
Ich vertage den Artikel um ein Jahr. Weihnachten braucht keine perfekten Sätze, sondern offene Arme. Und diese Nähe jetzt – wenn der Himmel nach etwas schmeckt, dann nach genau dem.