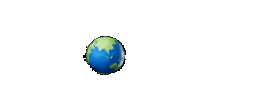Streit um die wahre Natur Jesu Christi: Das erste ökumenische Konzil der Kirchengeschichte schreibt Weltgeschichte und klärt die Grundsatzfrage des Glaubens – Teil zwei der Serie.
Die theologischen Streitigkeiten in den ersten Jahrzehnten des vierten Jahrhunderts sind verknüpft mit zwei Personen: Arius und Athanasius. Beide wirkten in der ägyptischen Stadt Alexandria am östlichen Mittelmeer – einem kulturellen Zentrum, in dem griechische Philosophie, jüdisches Denken und christliche Theologie aufeinandertrafen und sich gegenseitig beeinflussten.
Die Gegner: Arius und Athanasius
Die Vorstellungen des Arius – weitgehend mit dem Subordinatianismus (der Sohn ist Geschöpf und dem Vater nachgeordnet) identisch – fanden zwar bei vielen Geistlichen durchaus Zustimmung. Aber schon um 318 gab es zwischen Arius und dem Bischof Alexander Auseinandersetzungen über das Wesen des Sohnes. Alexander berief sogar in Alexandria eine Synode, in der die Positionen des Arius als Irrlehre verurteilt wurden.
Das Schreiben, das diese Verurteilung enthielt, wurde vermutlich von dem damaligen Diakon Athanasius verfasst, der später auf dem Konzil von Nizäa theologischer Berater des Bischofs Alexander war. Doch war die Verurteilung des Arius nicht Ende des Streits, sondern Beginn einer noch schärferen Auseinandersetzung, die nun auch überregionale Bedeutung erlangte.
Der Kaiser und das Konzil
Kaiser Konstantin wurde schließlich auf diese Auseinandersetzung aufmerksam. Obwohl der Kaiser dogmatische Fragestellungen eher als etwas Nebensächliches betrachtete und mehr auf Kultus und Ethos Wert legte, das heißt auf die Praxis des Glaubens, griff er in den Streit ein und berief 325 n. Chr. ein allgemeines Konzil in der kleinasiatischen Stadt Nizäa zusammen.
Nizäa lag nur 80 Kilometer östlich von Konstantinopel – dem Regierungssitz Kaiser Konstantins – und war damit für ihn gut zu erreichen, um jederzeit an den Sitzungen der Bischöfe teilnehmen zu können. Die Versammlung fand im kaiserlichen Sommerpalast statt. Es scheint so, dass ein Bischof, Ossius von Cordoba, die Sitzungen leitete. Dies alles geschah in enger Verbindung mit dem Kaiser.
Das Urteil der 300 Bischöfe
Das Konzil begann am 20. Mai 325, wann es endete, lässt sich nicht mehr feststellen – vermutlich dauerte es ein oder zwei Monate. An dem Konzil sollen 300 Bischöfe teilgenommen haben. Die Mehrheit kam aus dem Osten des Reiches, während aus dem Westen nur wenige Geistliche anwesend waren.
Von herausragender Bedeutung war das Konzil deswegen, weil es sich mit den Positionen des Arius auseinandersetzte, sie verurteilte und verbindliche Aussagen zum Verhältnis von Vater und Sohn traf. Der Glaube und die theologische Position des Athanasius hatten auf die Positionen, die das Konzil von Nizäa einnahm, den größten Einfluss.
Der Sohn ist wahrer Gott
Arius hatte zwar den Sohn auch als Gott bezeichnet, doch der einzig wahre Gott war für ihn der Vater, an dessen Gottsein der Sohn und der Heilige Geist, die vom Vater geschaffen wurden, einen gewissen Anteil hatten. Für Athanasius kam es vor allem auf den Erlösungsgedanken an: Allein der wahre Gott, der Mensch wird, ist in der Lage, den Menschen das Heil zu schenken.
Das Konzil kam zu der noch heute verbindlichen Erkenntnis: Der Sohn ist „wahrer Gott von wahrem Gott, gezeugt nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater.“ Das Bekenntnis macht deutlich, dass sich das Gottsein des Vaters und das Gottsein des Sohnes in nichts unterscheidet. Die Aussage, dass der Sohn vom Vater „gezeugt“ wird, soll nicht auf ein Nacheinander hinweisen, sondern auf ihre Wesensgleichheit. Der Sohn steht nicht unter dem Vater, sondern ist genauso Gott wie der Vater.
Mit der Einberufung des Konzils habe der Kaiser Konstantin „die durch inneren Hader und äußere Verfolgung tief bedrohte Kirche gerettet“, erläuterte der Kirchenhistoriker Adolf von Harnack. Und Athanasius habe „die Kirche vor der völligen Verweltlichung ihrer Glaubensgrundlagen bewahrt“. Er habe den übermächtigen Einfluss der griechischen Philosophie auf die Gotteslehre abgeschwächt und sich am heilsgeschichtlichen Geschehen orientiert, wie es im Neuen Testament bezeugt wird.
Das Konzil hatte entschieden, doch der Streit ging weiter. Darum geht es in der nächsten Folge dieser Serie.
Hintergrund: Das Glaubensbekenntnis von Nizäa (325)
Das Bekenntnis von Nizäa, in dem wesentliche theologische Positionen zur Gotteslehre und Christologie in wenigen bedeutungsvollen Sätzen festgehalten wurden, lautet:
„Wir glauben an einen einzigen Gott, Vater, Allherrscher, Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren, und an einen einzigen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, gezeugt aus dem Vater als einziger Sohn, das heißt aus dem Wesen des Vaters, Gott von Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, wesensgleich dem Vater, durch den alles geworden ist, was es im Himmel und auf der Erde gibt, der wegen uns Menschen und wegen unseres Heiles herab gekommen und Fleisch geworden ist und im Menschsein weilte, gelitten hat und auferstanden ist am dritten Tag, hinaufgestiegen in die Himmel und kommt zu richten Lebende und Tote, und an den Heiligen Geist.
Diejenigen aber, die sagen: ‚Es gab eine Zeit, da er [der Sohn] nicht war‘, und: ‚Bevor er gezeugt wurde, war er nicht‘, und er sei ‚aus nicht Seiendem geworden‘ oder aus einer anderen Substanz oder einem anderen Wesen, und behaupten, der Sohn Gottes sei entweder geschaffen oder wandelbar oder veränderlich, diese belegt die katholische [allgemeine] und apostolische Kirche mit dem Bann.“
In diesem Text findet sich das Bekenntnis zum Glauben, dass Vater und Sohn wahrer Gott sind. Zwar wird der Heilige Geist genannt, doch wird über das Verhältnis des Heiligen Geistes zu Vater und Sohn noch nichts ausgeführt. Dies geschieht erst mehr als 50 Jahre später auf dem ersten Konzil von Konstantinopel (383 n. Chr.).
Am Ende des Bekenntnisses steht eine Verurteilung all jener, die diese Lehre nicht annehmen. Sie werden mit einen „Bann“ belegt, damit soll die Verbindlichkeit der Aussagen zu Vater und Sohn deutlich gemacht werden. Es wird zum Ausdruck gebracht, dass das Gottsein von Vater und Sohn unverbrüchlich zum christlichen Glauben gehört.
Foto: Yevhen – stock.adobe.com