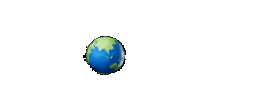Was bewegt einen Menschen, der vorhat, sich das Leben zu nehmen? spirit stellte die Frage vor einigen Jahren drei Menschen, die vom Thema Suizid unmittelbar betroffen sind. Einige Tage nach dem Welttag der Suizidprävention hier ihre Antworten.
Am Welttag der Suizidprävention berichteten wir, welche Hilfestellungen man Menschen, die suizidal sind, geben kann. Wichtig ist vor allem: zuhören und Gespräche möglich machen. In diesem Artikel sollen Menschen, die persönlich von Suizid betroffen sind, zu Wort kommen.
Die Vorgeschichte
Sabine* war zwölf Jahre alt, als sie ihren ersten Suizidversuch unternahm. Sie erinnert sich noch genau an die Situation: „Meine Mutter hatte mich, weil ich eine schlechte Note mit nach Hause gebracht hatte, so mit einem Handfeger verprügelt, dass ich gesagt habe: Bring mich doch um. Ich habe ihre Schlaftabletten genommen – aber zu wenige. Meine Mutter weckte mich dann, sie hatte gar nicht mitbekommen, dass ich mir das Leben nehmen wollte. In solchen Situationen ist man einfach leer, man steht total neben sich. Sinnvolle Entscheidungen kann man nicht mehr treffen, alle Gedanken gehen nur noch in eine Richtung: Ich will jetzt nicht mehr da sein.“ Die Ursache ist für Sabine klar: „Ich war zuhause nie geborgen, meine Eltern haben mir keinen Rückhalt gegeben. Ich hatte das Gefühl, dass sie mich nicht lieben.“
Ähnlich ging es Julia*, die ebenfalls als Kind zum ersten Mal Suizidgedanken hegte: „Von meinen Eltern bekam ich nicht viel Rückendeckung. Ich hatte das Gefühl, mit ihnen über nichts reden zu können. Sie waren für mich keine Vertrauenspersonen. Auch heute noch fällt es mir schwer, anderen zu vertrauen oder Zuneigung anzunehmen. Ich habe das Gefühl, nicht liebenswert zu sein. Ich war immer die Außenseiterin, auch in der Schule.“
Peter*, dessen Bruder Hans sich mit 52 Jahren das Leben genommen hat, ist sich sicher, dass Hans in der Familie nicht weniger geliebt wurde als seine drei Brüder. Dennoch hat er sich wohl oft zurückgesetzt gefühlt, denkt Peter: „Er hat das Leben nie leichtgenommen. Vor vier Jahren brach dann seine ganze Existenz auseinander: Er verlor seine Arbeitsstelle, seine Ehe wurde geschieden, sein Priesteramt ruhte. Er schämte sich so sehr, dass er nicht mehr in seine Heimatgemeinde gehen wollte, und so verlor er auch seine privaten Kontakte. Das war wohl alles zu viel für ihn, da hat er sich das Leben genommen.“
Selbsttötung als letzte Option
„Als Kind dachte ich, wenn ich in meinem Leben nicht gut klarkomme, kann ich mir ja immer noch das Leben nehmen“, erzählt Julia. Auch Sabine hält sich diesen „letzten Ausweg“ offen, selbst wenn sie das für egoistisch hält: „Es ist meine letzte Möglichkeit Frieden zu finden. In dem Moment denkt man nicht an seine Familie. Was danach kommt, ist einem völlig egal.“
Hans dagegen hat seinen Suizid sorgfältig geplant und sich Mühe gegeben, andere möglichst wenig mit seiner Tat zu belasten: Er hatte sich rasiert und seinen Personalausweis eingesteckt, bevor er aus dem Fenster seiner im sechsten Stock gelegenen Wohnung sprang. Weil unter dem vorderen Fenster ein Kinderspielplatz liegt, ist er aus dem nach hinten gelegenen Zimmer gesprungen. In einem Abschiedsbrief bat er seine Familie um Verzeihung für den Schmerz, den er nun verursachen würde, und erklärte, er habe Gott um Kraft für sie gebeten.
Als Erwachsene versuchte auch Sabine noch einmal aus dem Leben zu fliehen, diesmal mit genug Tabletten. Doch der Plan misslang. Ihr Mann trat die Tür ein und brachte sie ins Krankenhaus, wo ihr der Magen ausgepumpt wurde. „Als ich aufwachte, war mein erster Gedanke: Es hat wieder nicht geklappt, du warst wieder nicht gut genug, du hast es wieder nicht geschafft.“
Wege zurück ins Leben
In den Wochen danach sind die Gefühle ambivalent: Dem Bedauern, noch am Leben zu sein, steht der Gedanke gegenüber: „Wer weiß, wo du hingekommen wärst?“ Darüber hat Julia während ihrer suizidalen Phasen nie nachgedacht, für sie stand der Wunsch nach endgültiger Ruhe, endgültigem Frieden im Vordergrund. Angst vor dem Tod hatte sie kaum: „Was soll denn schlimmer sein als mein jetziges Leben?“ Und auch Sabine ist nicht sicher, wie sie ihr Weiterleben bewerten soll: „Ob ich froh bin, kann ich nicht sagen. Mein Leben hat Früchte getragen. Aber auch heute noch halte ich den Tod für etwas, das wirklich Erlösung bringen kann.“ Ihr hat eine Therapie geholfen, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Und sie ist überzeugt, dass dies auch für andere der richtige Weg sein kann: „Man sollte sich nicht davor scheuen, einen Psychologen aufzusuchen. Ich kann heute mit einigen Dingen besser umgehen. Wenn ich heute darüber nachdenke, war der liebe Gott – wenn auch spät – doch immer da und hat mich letztendlich am Rande meiner Kapazität wieder herausgeholt. Jetzt stellt sich die Frage: Wofür musste ich das durchmachen? Vielleicht, um einem anderen, dem es genauso geht, helfen zu können.“
Denn in einem sind sich Julia, Sabine und Peter einig: Am besten kann helfen, wer selbst schon etwas Ähnliches durchgemacht hat, nur er kann wirklich nachfühlen, wie es dem anderen geht. Freunde und Angehörige konnten weder Sabine noch Julia helfen, beide haben ihrer Umgebung nichts von ihren Gedanken mitgeteilt. Auch Peter hat zwar geahnt, dass Hans suizidgefährdet sein könnte, aber keine konkreten Signale von ihm erhalten: „Hans hat ab und zu Andeutungen gemacht wie: Was soll das alles noch? Oder: Es wäre am besten, gar nicht mehr da zu sein; da habe ich mir schon Sorgen gemacht. Ich habe dann intensiven Kontakt zu ihm gesucht, wir haben viel gemeinsam unternommen. Trotzdem konnte ich ihm letztendlich nicht helfen.“
*Namen von der Redaktion geändert
Dieser Artikel ist in einer längeren Fassung ursprünglich in der neuapostolischen Kirchenzeitschrift spirit, Ausgabe 05/2008, erschienen.