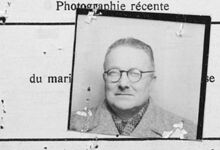Ein Trend der traurig macht
Am 20. Juni findet der von den Vereinten Nationen initiierte Weltflüchtlingstag statt. Traditionell wird an diesem Tag besonders für Solidarität mit Geflüchteten geworben. Aktuell warnt die UNHCR besonders vor herrschender Gleichgültigkeit.

Aktuell wie nie
Seit über zehn Jahren muss ein Satz in der Medienberichterstattung nur durch die aktuelle Jahreszahl aktualisiert werden: „Noch nie waren so viele Menschen auf der Flucht wie im Jahr 20xx“. Dass sich die Zahl der Flüchtenden in dieser Zeit verdoppelt hat, ist der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt.
Gegründet wurde die UN Refugee Agency (UNHCR) im Jahr 1950, um Millionen von Menschen zu helfen, welche während des zweiten Weltkrieges ihr Zuhause verloren hatten. Dem ursprünglichen Plan nach sollte das Hochkommissariat der Vereinten Nationen nur drei Jahre lang existieren und nach getaner Arbeit wieder aufgelöst werden.
Weltweite Krisen und Notsituationen führten jedoch dazu, dass das Organ der Vereinten Nationen noch 70 Jahre später existiert und in jedem Jahresbericht über neue Höchstwerte zu berichten hat.
Rekordzahlen und Einzelschicksale
So sind laut dem Flüchtlingshilfswerk 2023 über 117 Millionen Menschen gezwungen, ihr Heim zu verlassen und zu fliehen. 40 Prozent dieser Menschen sind unter 18 Jahre alt. Allgemein trifft dieses Schicksal junge Menschen besonders hart, welche sich so ihrer Zukunft beraubt sehen. Auf der Flucht wurden in den letzten Jahren durchschnittlich 339.000 Kinder pro Jahr geboren. Entgegen mancher vehement geäußerten Meinung ist dennoch klar: Keiner dieser Menschen flieht ohne Grund. „Hinter diesen drastischen und steigenden Zahlen verbergen sich unzählige menschliche Tragödien,“ so Filippo Grandi, der der UN-Hochkommissar für Menschen auf der Flucht. Ob Kriege, Verfolgung von Minderheiten, Hungersnöte und zunehmen Naturkatastrophen. Die Gründe für Flucht haben absolut nichts mit Tourismus zu tun.
Flucht bedeutet, seine Heimat, Familie und Freunde zurückzulassen und sich mit dem absolut Notwendigsten auf den Weg zu machen. Flucht bedeutet, nicht zu wissen, was die Zukunft bringt und ein Leben, ja Überleben auf der Straße, dem Meer, in Not-Unterkünften und Zeltstädten. Sowie das Erleben von Gleichgültigkeit oder gar Ablehnung.
Gott als Fluchthelfer und Flüchtling
Wer darauf verweist, dies sei primär ein Thema der Weltpolitik und nicht des christlichen Glaubens, ignoriert schlicht und ergreifend dessen Grundlage: Die Bibel.
Israels Exodus aus der Knechtschaft Ägyptens prägt das Bild des befreienden und in die Wüste begleitenden Gottes nachhaltig. Aber auch sonst sind die biblischen Texte sehr von Migrationserfahrungen geprägt. Der Wirtschaftsflüchtling Abraham, der mit seinem ganzen Besitz in Ägypten Zuflucht suchte. Oder Jakob wie auch David, welche um ihr Leben fürchteten und deshalb flohen. Die Geschichte des Lots, welcher aus dem brennenden Sodom flieht. Noah flüchtete mit seiner Familie vor einer Naturkatastrophe. Die Liste der Geflüchteten, über welche die Heilige Schrift berichtet, ist noch viel länger. Die Flucht Josefs und Marias mit dem gerade geborenen Jesu erinnert daran: Gott wurde in der Person Jesu selbst zum Flüchtling.
„Was kann ich schon ausrichten?“
Der Einzelne merkt sehr wohl, dass die eigene Hilfsbereitschaft zwar uneingeschränkt sein kann, die tatsächlich mögliche Hilfe jedoch sehr wohl Grenzen hat. Dies bedeutet nicht, dass man nach dem Motto verfahren sollte: „Wenn ich nicht allen helfen kann, helfe ich keinem.“
Viele Bibelstellen beschreiben, wie mit dem Fremden umzugehen sein sollte. Ein gutes Bild ist das des Endgerichtes in Matthäus 25, 35ff. In dem hilfsbedürftigen Fremden begegnet man Christus, Gott, und hat dabei die Möglichkeit, ihn aufzunehmen oder abzulehnen.
Stammapostel Jean-Luc Schneider unterstrich, wie wichtig es sei, in der Nächstenliebe aktiv zu werden: „Wir sind im Neuen Bund, da gilt nur eins, um Heil zu erlangen: der Glaube, der in der Liebe tätig wird.“
Die Relevanz des sozialen Engagements ist ebenfalls im Katechismus klar beschrieben:
Die Neuapostolische Kirche ist dem Evangelium und den Geboten christlicher Ethik verpflichtet. Sie sieht ihre Aufgabe unter anderem in „praktizierter Nächstenliebe“, die den Menschen ohne Ansehen von Geschlecht, Alter, Hautfarbe, Nationalität und Religion zugutekommt. So wird im Rahmen der Möglichkeiten Menschen geholfen, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden. Getragen wird diese Arbeit durch das ehrenamtliche Engagement vieler Helfer aus den Gemeinden, aber auch durch materielle Hilfeleistung.
Sich daran orientierend setzt die Kirche viele Projekte in der Zusammenarbeit mit diversen Hilfswerken um.
Und doch ist es auch die Verantwortung des Einzelnen, wo immer möglich, Nächstenliebe zu praktizieren. Oder wie Grandi sagt: „Kein Mensch flieht freiwillig – aber ganz freiwillig können wir uns entscheiden, diesen Menschen zu helfen.“
Foto: Bilal - stock.adobe.com
Artikel-Infos
Autor:
Datum:
Schlagworte:
Simon Heiniger
20.06.2024
Hilfswerke,
Soziales Engagement,
Gemeindeleben